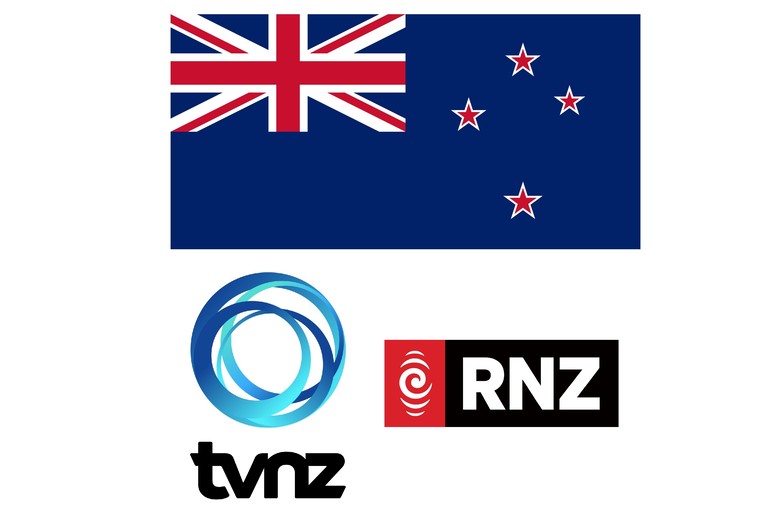Wellington (KNA) Der innenpolitische Druck auf Neuseelands Labour-Premierminister Chris Hipkins, Amtsnachfolger von Jacinda Ardern, die Fusionspläne für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kurz vor dem Starttermin noch aufzuhalten, ist immens. Aus deutscher Sicht macht die Medienpolitik in Down Under ohnehin einen Kopfstand: Denn in Neuseeland sind es nicht konservativ-liberale bis rechtspopulistische Parteien sondern vielmehr die Sozialdemokraten um Hipkins, die die beiden teils mit Steuern finanzierten Sender Television New Zealand (TVNZ) und Radio New Zealand zu einer Anstalt verschmelzen wollen. Anders als in Deutschland sehen oppositionellen Kräfte im Parlament der Hauptstadt Wellington keine Synergie-Effekte, die sich bei einer solchen Fusion ergeben könnten. Ganz im Gegenteil: Politiker von Nationalpartei und ACT New Zealand meinen, mit einer Verschmelzung von Radio und Fernsehen seien Programm- und Meinungsvielfalt in Gefahr. Sollten die beiden liberal-konservativen Parteien bei den Parlamentswahlen am 14. Oktober 2023 triumphieren, wollen sie einen fusionierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneut in zwei einzelne Anstalten aufspalten. Labour regiert seit 2020 im Land am Südpazifik mit absoluter Mehrheit und kooperiert auf freiwilliger Basis mit den Grünen und der indigenen Maori Party. Diese Parteien haben im vorigen Jahr beschlossen, den Verschmelzungsprozess von TVNZ und RNZ in wenigen Wochen, nämlich am 1. März, einzuleiten. Als Starttermin für die neuen Programme ist der 1. Juli 2023 anvisiert. Im Einzelnen sehen die Pläne folgendes vor: Eine gemeinsame Intendanz soll die neue Anstalt führen, weitgehend unabhängig von Regierungseinflüssen und mit redaktioneller Eigenständigkeit, wie Vertreter von Labour, den Grünen und der Maori-Partei betonen. "Aotearoa - Land der langen weißen Wolke", nannten die Ureinwohner, die Maori, Neuseeland einst. "Aotearoa New Zealand Public Media" (ANZPM) soll deshalb die neue Rundfunkanstalt heißen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt könnten die einzelnen Sender griffigere Namen bekommen. Anders als in Deutschland ist eine Abschaltung von Programmen in Neuseeland ausdrücklich nicht vorgesehen. Vor ihrem Rücktritt hatte Jacinda Ardern als Ziel der geplanten Fusion ausgegeben, "die Stimme Neuseelands stärken" zu wollen. Mit einem großen Rundfunksender, der nach dem Vorbild der ABC im benachbarten Australien auch international wahrgenommen werde. Zugleich gehe es darum, auf einen veränderten Medienkonsum, auf neue Technologien und auf einen gewachsenen globalen Wettbewerb insbesondere im Fernsehsektor zu reagieren. Denn wie in anderen Ländern, meint Ardern, die seit kurzem nur noch als einfache Abgeordnete im Parlament sitzt, würden junge Erwachsene klassische TV-Angebote kaum noch nutzen. Die Radioprogramme RNZ National, RNZ News und RNZ Concert sind bislang weitgehend werbefrei und sollen es im Zuge der geplanten Umstrukturierung auch bleiben. Die Fernsehanstalt TVNZ finanziert sich hingegen nicht allein aus staatlichen Zuschüssen, sondern zu fast 90 Prozent mit Werbespots, die in Neuseeland (quasi nach US-amerikanischen Vorbild) ungefähr alle zehn Minuten das Programm unterbrechen und sich auf diese Art auf bis zu 20 Minuten pro Stunde summieren. Während Werbeeinblendungen auch beim künftigen Sender ANZPM omnipräsent sein dürften, soll "eine stärkere Orientierung am Publikumsinteresse" die bisherige kommerzielle Gesamtausrichtung von TVNZ ersetzen. Im Jahr 2000 wurden die Rundfunkgebühren von umgerechnet 65 Euro im Jahr für die Neuseeländer abgeschafft und mit einer Finanzierung aus dem Haushalt ersetzt. Rund 400 Millionen Dollar umfasst das geschätzte jährliche Gesamtbudget von ANZPM, umgerechnet 240 Millionen Euro. Daneben hat die Regierung Kapital in fast gleicher Höhe für den neuen Sender in den Haushalt gestellt. Diese Summen sind im Vergleich zu deutschen Rundfunkbudgets auffällig gering, was nicht zuletzt daran liegt, dass es in den Programmen von TVNZ bislang kaum Eigenproduktionen gibt. Das neuseeländische Fernsehen zeigt überwiegend Hollywood-Kino und TV-Serien aus den USA, aus Großbritannien und Australien. Folgerichtig sieht sich der US-amerikanische Unterhaltungskonzern Warner Bros. Discovery bereits als Verlierer der Fusionspläne. Ab 1. Juli 2023 will die Regierung das Budget von ANZPM um weitere 50 Prozent erhöhen, um eine bessere Programmqualität zu gewährleisten und eine Ausweitung von Diensten wie etwa TV on demand zu ermöglichen. Inhaltlich soll ANZPM stärker als die bisherigen Sender die Kulturen der Maori und anderer Minderheiten berücksichtigen. Geplant ist, auch Menschen in benachbarten pazifischen Inselstaaten mit neuseeländischen Radio- und Fernsehprogrammen zu versorgen. Die Verschmelzung der beiden bisherigen Rundfunkanstalten soll nicht zuletzt einer von der Regierung beklagten "zunehmenden Desinformation durch Online-Plattformen" begegnen und die Marktmacht dieser Plattformen zurückdrängen. Die Programme von ANZPM sollen wesentlich höhere Anteile an Eigenproduktionen ausweisen, vor allem mit heimischen Dokumentationen, aber auch mit Unterhaltungsserien und Comedy-Shows. Simon Power, Vorstandsvorsitzender von TVNZ, hält eine Verschmelzung der öffentlich-rechtlichen Sender angesichts der fortschreitenden Digitalisierung für eine "großartige Chance", selbst wenn er seine persönliche Macht in diesem Fall teilen müsste. Ganz ähnlich äußert sich RNZ-Vorstand Jim Mather. Sollten die Regierungspläne kurzfristig hingegen noch scheitern und TVNZ und Radio New Zealand als einzelne Anstalten fortgeführt werden, drohen Zuschauerverluste durch digitale Konkurrenzangebote aus dem Ausland, heißt es in einem mahnenden Beitrag des Medienmagazins "Media Watch". Der frühere Intendant von Radio New Zealand, Geoffrey Whitehead, hat für diesen Fall bereits eine neue Gesetzesinitiative erarbeitet. Whitehead schwebt eine komplett werbefreie "Broadcasting Corporation of New Zealand" (BCNZ) vor, die ausschließlich mit Gebühren der Steuerzahler finanziert werden soll. Umfragen zufolge bewertet Neuseelands Bevölkerung die derzeitigen Fusionspläne überwiegend positiv. Das Institut "Research NZ" befragte Menschen auf der Straße: Demnach befürworten rund 44 Prozent einen großen, öffentlich-rechtlichen Sender, 29 Prozent lehnen eine Zusammenlegung ab. In der Zielgruppe der 18- bis 24-Jährigen liegt die Zustimmung für neue Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei 65 Prozent. "Dies zeigt, dass die Regierung mit den ANZPM-Plänen richtig liegt", sagt Myles Thomas vom "Better Public Media Trust". Nach Abschluss der Umwandlung würde das Vertrauen weiter wachsen, meint Thomas. Auf die Debatte über eine Neuordnung der Rundfunkanstalten in Deutschland lassen sich die Reformpläne des pazifischen Inselstaats aber aus einem ganz einfachen Grund nicht so einfach übertragen: Während Sender wie ARD und ZDF eine Bevölkerung von rund 85 Millionen Menschen mit Programmen versorgen und deren gesellschaftliche Vielfalt abbilden sollen, erreichen TVNZ und Radio New Zealand zusammen kaum mehr als fünf Millionen Menschen.