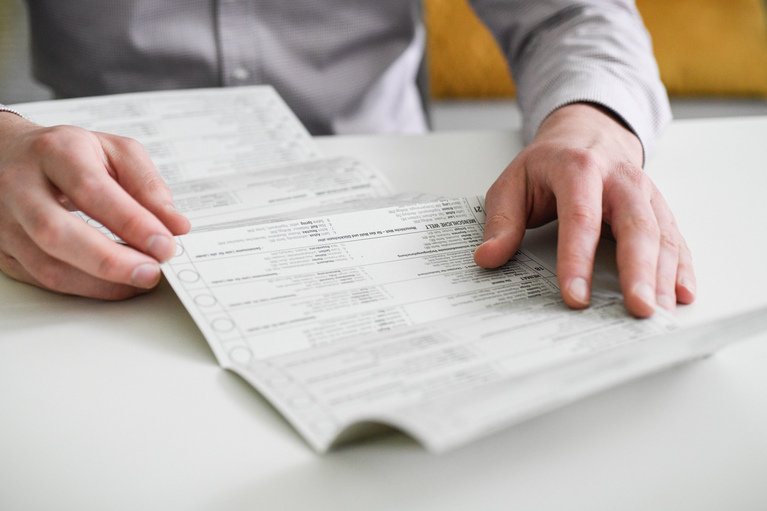Saarbrücken/Berlin (KNA) Dieter Dörr ist einer der profiliertesten Medienrechtler Deutschlands und Experte für Rechtsfragen vor allem zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er war von 1995 bis 2017 Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht sowie Medienrecht an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, wo er noch bis 2020 eine Senior-Forschungsprofessur hatte. Von 2000 bis 2018 war Dörr auch Direktor des Mainzer Medieninstituts. KNA-Mediendienst: Herr Dörr, der SWR muss entgegen seiner ursprünglichen redaktionellen Planung die Spitzenkandidaten des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) voraussichtlich in eine Sendung zur Bundestagswahl einladen. Wie verträgt sich das mit der Programmfreiheit? Dieter Dörr: Die öffentlich-rechtlichen wie die privaten Sender dürfen ihre Sendungen - das ist grundrechtlich geschützt - redaktionell frei gestalten, müssen dabei aber die abgestufte Chancengleichheit beachten. Die redaktionellen Konzepte müssen also in sich schlüssig sein. Es gab zum Beispiel den Fall, dass sich der damalige Kanzlerkandidat der FDP, Guido Westerwelle, beim Kanzlerduell einklagen wollte. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die redaktionelle Konzeption ist nachvollziehbar, nur die beiden Kandidaten der stärksten Parteien einzuladen, die auch wirklich die Chance haben, sich durchzusetzen. Und dass deshalb eine vergleichsweise wesentlich kleinere Partei, die zur Wahl antritt, nicht das Recht hat, an dieser Sendung beteiligt zu sein. Beim Südwestrundfunk war es jetzt so, dass dort auf die mittlere Stärke der Parteien abgestellt wurde - und da war es nicht nachzuvollziehen, dass man die FDP einlädt, aber das BSW nicht. MD: Macht dieses detailliert festgelegte System noch Sinn, wenn wir gleichzeitig jemanden wie Elon Musk auf X mit Parteiwerbung für die AfD haben - getarnt als Interview oder Gespräch mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel? Dörr: Da sprechen Sie eine zentrale Frage des gesamten Medienrechts an: Wie haben bisher die sogenannten Intermediäre, wie wir juristisch soziale Netzwerke und vergleichbare Dienste nennen, in keiner Weise hinreichend beachtet. Und wir haben dafür auch keine passenden Regelungen aufgestellt. Wir haben völlig unterschätzt, dass diese Einrichtungen Meinungsmacht besitzen. Diesen Vorwurf müssen wir übrigens auch den klassischen Medien machen - die waren da auch sehr blauäugig. MD: Worin besteht diese Blauäugigkeit? Dörr: Wir haben lange Zeit die Vorstellung vor uns hergetragen, diese Dienste verbreiten nur andere Medien oder deren Inhalte und fremde Meinungen weiter und haben selbst keinerlei Einfluss auf die Inhalte. Was natürlich - um es ganz deutlich zu sagen - Unsinn ist. Wer die Algorithmen oder gleich die ganze Einrichtung in der Hand hält, wie Elon Musk, bestimmt auch, was nach oben gespült wird und was unten bleibt. Es ist ja bemerkenswert, dass sich in diesen Netzwerken Hass, Hetze und Desinformation viel besser verbreiten, oder wie man neudeutsch sagt, viral gehen, als seriöse Inhalte. MD: Wieso hat man sich hier so lange abwartend verhalten? Dörr: Die politischen Gestalter, aber auch zum großen Teil die Wissenschaft, haben das völlig unterschätzt. Dabei gibt es dazu seit Längerem sehr umfassende Untersuchungen, die Landesmedienanstalten haben sich relativ früh dieser Problematik angenommen. Was jetzt passiert, sieht man ja bei Elon Musk in aller Deutlichkeit - aber auch die sogenannten etablierten Parteien unterschätzen die Gefahr bis heute. Die meinen, wenn sie selbst auf X, Tiktok oder Instagram sind, hätten sie dort die gleichen Chancen wie radikale Parteien. Das stimmt aber nicht, solange die Algorithmen die Inhalte steuern und bestimmte Inhalte ganz massiv nach oben spülen. MD: Wie verhält es sich denn rein rechtlich damit? Dörr: Der Gesetzgeber hat eben die Medienintermediäre nur ganz am Rande in den Medienstaatsvertrag einbezogen - aber es gibt keine Regeln dafür, dass dort das Gleiche gilt wie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Presse. Doch das müsste nach meiner Meinung unbedingt so sein! MD: Haben Sie eine Erklärung für diese Zurückhaltung? Dörr: Am Anfang wurde das mit Sicherheit unterschätzt. "Bei Tiktok werden doch nur Katzenvideos verbreitet", war so die Antwort, die man erhielt, wenn einige Kollegen und auch ich gewarnt haben, dass da eine ungeheure Meinungsmacht entsteht - unvergleichlich höher als die der ganzen deutsche Presse zusammen. Außerdem sind die klassischen Medien für ihre eigene Verbreitung auf die Intermediäre angewiesen, und deshalb scheut man erkennbar, sich mit ihnen anzulegen. Wie ich leider feststellen muss, reicht das auch bis in die Wissenschaft. Denn die profitiert - Stichwort Drittmittel und Förderung - ebenfalls von diesen Big Playern aus den USA und China. MD: Realistisch gesehen - welche Chancen gibt es denn noch? Dörr: Die einzige realistische Chance haben Regelungen auf europäischer Ebene. Hier haben die Europäische Kommission und andere europäischen Institutionen übrigens schon mehr getan als der deutsche Gesetzgeber. Sie waren durchaus sehr kritisch mit den Intermediären und versuchen auch, ihre Regelungen aufrechtzuerhalten ... MD: ... während Tech-Konzerne in den USA schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump angekündigt haben, die ohnehin wenigen Vorschriften zur Moderation und Beschränkungen von Inhalten in den sozialen Medien wieder abzuschaffen. Dörr: Es ist natürlich überhaupt nicht überraschend, dass ein Präsident Trump das anders sieht. Denn er profitiert ja davon, wenn sich Hass, Hetze und Halbwahres besonders schnell und intensiv verbreitet. Auch bei uns in Deutschland ist ja inzwischen das Missverständnis eingetreten, Meinungsfreiheit bedeute, dass man im Internet alles, auch Hass, Hetze und Gewaltaufrufe, von sich geben darf. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in der Künast-Entscheidung gerade für die Welt des Internets klare Grenzen zwischen Meinungsfreiheit auf der einen und Persönlichkeitsrechten auf der anderen Seite festgeschrieben. Übrigens auch, dass noch größere Sorgfaltsregeln gelten, wenn sich solche Aussagen besonders schnell und weitreichend verbreiten können. Diese Entscheidung ist aber bei den Zivilgerichten bis heute immer noch nicht richtig angekommen. Da herrscht weiterhin oft die Auffassung, alles, was nicht gegen die Menschenwürde verstößt, oder eine Formalbeleidigung ist, wäre als Meinungsäußerung zulässig. MD: Wie unterscheiden sich hier die USA und die EU beziehungsweise Deutschland? Dörr: Anders als in den USA gilt die Meinungsfreiheit in keiner Weise grenzenlos, das steht schon so im Grundgesetz. Dort heißt es klar: "Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre." Wir haben ein System der Abwägung. Das gilt in der Welt des Internets in besonderer Weise. Keine Politikerin, kein Politiker muss sich jede Herabsetzung, jeden Hass, gefallen lassen. Das Gegenteil ist richtig. MD: Kommen wir zurück zur Berichterstattung vor der Wahl. Was halten Sie davon, dass es nur ein Kanzlerduell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz geben soll? Dörr: Das ist mit Blick auf die abgestufte Chancengleichheit sehr, sehr problematisch. Denn es gibt ja noch eine weitere Partei, die sogar durchgehend bei allen Umfragen die zweitstärkste ist. MD: Wollen Sie damit sagen, dass sich eigentlich Alice Weidel und Friedrich Merz duellieren müssten? Dörr: Nein, ich würde sagen, alle vier müssten eingeladen werden. Denn wenn ich die Meinungsumfragen richtig präsent habe, besteht kaum ein Unterschied zwischen SPD und Grünen. Natürlich ist es angesichts der Aussagen aller anderen Parteien relativ unrealistisch, dass Frau Weidel wirklich Kanzlerin werden könnte. MD: Und die Planung jetzt nur Scholz und Merz zum Duell einzuladen? Dörr: Das passt aus meiner Sicht nicht. Denn Sie können schwer begründen, dass nur die beiden Chancen haben, Kanzler zu werden. Man wird das redaktionell zu rechtfertigen versuchen mit Argumenten wie "Wir laden den bisherigen Amtsinhaber und den stärksten Herausforderer ein". Aber ob das wirklich hält, muss man sehen. MD: Ihre Prognose? Dörr: Bei mir bleibt ein ungutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut, die nach Umfragen zweitstärkste Partei deshalb zu benachteiligen, weil sie einem inhaltlich nicht passt. Das Verfassungsgericht hat bei der abgestuften Chancengleichheit immer gesagt, diese gilt für alle Parteien, solange sie nicht verboten sind. Selbst wenn Parteien verfassungswidrige Inhalte vertreten - solange sie nicht verboten sind, findet das Anwendung. Die einzige Grenze ist das Strafrecht. Außerdem ist diese Entscheidung mit Blick auf die AfD schon deshalb kontraproduktiv, weil diese Partei sattsam dafür bekannt ist, sich in einer Art Opferrolle selbst zu dramatisieren. Mit genau solchem Verhalten erhöht man die Wahlchancen der AfD. Wir müssen nur in die USA gucken - dort hat es Trump auch hervorragend verstanden, sich immer in eine Opferrolle zu begeben und hat sich vom Mainstream und dunklen Mächten verfolgt gefühlt. MD: Warum machen die Sender das dann? Dörr: Es ist natürlich schwer, die AfD argumentativ zu stellen. Ihre Vertreter sind schon sehr geschickt in Diskussionen, indem sie einfach nicht auf Sachargumente eingehen. Doch nach unserer Vorstellung von Demokratie und freiheitlichem Rechtsstaat müssen sich die Vernunft und das bessere Argument durchsetzen. Aber das stimmt leider nur sehr begrenzt. Denn aktuell setzt sich in den sozialen Medien nach ganz anderen Regeln das durch, was viral geht. Und da wird gerade nicht die Wahrheit und das gute Argument nach oben gespült. Da schwimmt leider der Dreck ganz oben.